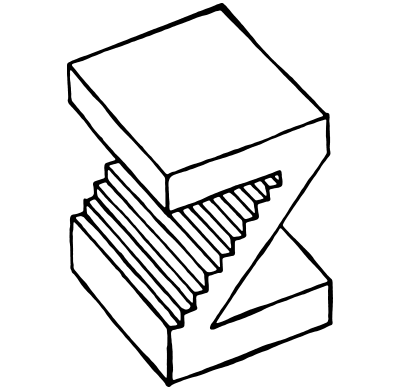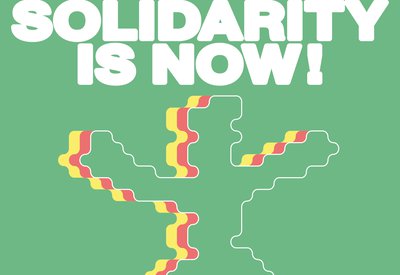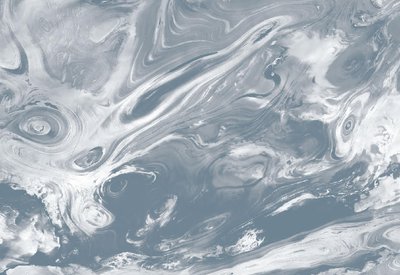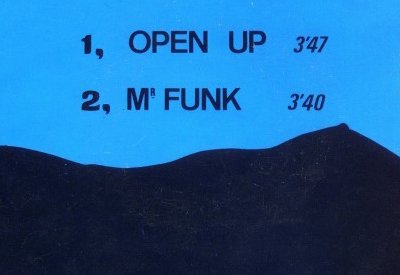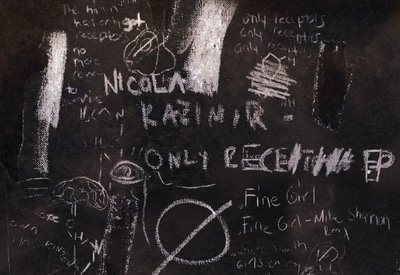Kein anderer DJ repräsentiert Kompakt, den szenebildenden Kölner Zusammenschluss aus Label, Plattenladen, Vertrieb und Booking-Agentur so wie Michael Mayer. Dabei spielt er keineswegs nur den minimalen Techno, mit dem Kompakt den Technosound der frühen 2000er geprägt hat. Aus einem Bewusstsein für die Tiefenstrukturen der Musik integriert Mayer Techno, House, Pop und Disco. Er bedient seine Crowd nicht, sondern verführt sie. Er überrascht das Publikum und fordert es heraus – in der Zukunft mit einem seiner legendären Acht-Stunden-Sets.

Was haben die Party People in der Zukunft von dir zu erwarten?
— Das weiss ich auch noch nicht so recht. Ich neige dazu zu improvisieren. Ich bereite mich natürlich vor, ich packe meine Plattentasche und meine Festplatte. Was letzten Endes dann passiert, muss man sehen. Ich war noch nie in der Zukunft, ich kenne den Raum noch nicht, ich kenn die Vibes noch nicht. Ich bin aber relativ breit aufgestellt, es kann alles passieren, von einem schönen, ausgedehnten Warm-Up bis zu Donnertechno und Disco - und wieder zurück.
Wie bereitest du dich auf so eine Nacht vor? Wie packst du deine Platten und deine Files?
— Ich habe mir über die Jahre eine dicke Festplatte erarbeitet mit Kategorisierungen wie Ambient, Warm-Up, Beat, Prime-Time oder Late-Night. Da sind mittlerweile 5000 oder 6000 Files drauf. Damit kann ich arbeiten. Beim Vinyl ist es spezifischer. Da packe ich ein paar alte Schätzchen ein, ein paar Platten für den Anfang und ein paar, die ich gerade gekauft hab.
Wie reagierst du dann auf den Vibe, auf die Stimmung im Club?
— Ich spanne immer diese Erzählbögen. Ich bin ein narrativer DJ, ich bin nicht nur auf Druck und Druckaufbau ausgerichtet, bei mir verlaufen diese Kurven ein bisschen wilder. Gerade, wenn ich so lange spiele wie jetzt in der Zukunft, geht es mir darum, dass ich nicht drei Stunden durchbrettere, sondern den Sound immer wieder breche mit anderen Ausdrucksformen. Da muss man als DJ auch das Gespür dafür haben, wie weit man seine Idiosynkrasien ausleben kann und wann man wieder Gas geben muss.
Wie ist das Verhältnis von aktuellen Sachen zu älterer Musik in deinen Sets?
— Ich bin ein erklärter Gegner der Retromania, die leider gerade überall vorherrscht. Ich spiele zu 85% aktuelle Veröffentlichungen, die nicht älter sind als ein Jahr. Nicht nur ich leide darunter, dass es diese Fixierung auf die Vergangenheit gibt, sondern die ganze Szene, das ganze Business. Wenn man sich ankuckt, dass sich das Reissue von einer Italo-House-Platte von 1993 besser verkauft als die meisten aktuellen Veröffentlichungen, dann besorgt mich das. Die Kids geben horrende Summen für Platten aus den frühen Neunzigern aus, aber kaum noch Geld für das, was unsere zeitgenössischen Künstler gerade so auf Platte pressen. Das höre ich auch, wenn ich mit anderen Vertrieben und mit den Labels spreche. Die ächzen gerade. Ich bin gespannt, wie das in 20 Jahren aussieht: Die Platten, die heute bloss noch in 300er Auflagen rauskommen werden dann vielleicht zu irren Preisen gehandelt werden, wenn das 2010er Revival ansteht.
Bisher gab es noch nicht mal ein 2000er Revival.
— Es scheint, als hätte die Heiligsprechung von gewissen Genres, Acts und Szenen mit den Nullerjahren aufgehört. Das Nuller-Revival hätte schon längst kommen müssen, aber irgendwas sperrt sich da dagegen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Dass sich die Kids für die Grundlagen der Musik interessieren, ist nachvollziehbar, aber irgendwie konstatiere ich da einen gewissen Stillstand. Für mich als DJ spielt der Retrosound keine Rolle.
Spürst Du, dass die neue Musik schwerer vermittelbar ist?
— Die aktuelle Landschaft ist ein stilistisches Minenfeld. Viele Musikstile, die immer in meinen Sets stattgefunden haben, wurden gettoisiert. Die romantische Angelegenheit wurde von Innervisions übernommen, die angetranceten Sachen, die ich auch immer gerne mochte, wurden von Tale of Us und Afterlife besetzt. Dabei gibt keinen aktuellen, dominierenden Sound mehr, es geht eh immer nur um Nuancen. Mich interessieren die Platten, die ausreissen, die was anderes versuchen. Ich versuche die Platten in anderen Kontexten zu spielen.
Du stehst zwar für Kompakt, dennoch bildest du das gesamte, gradlinige Spektrum der Clubmusik bis hin zu Disco und Pop ab. Dabei zieht sich eine bestimmte Emotionalität, ein bestimmtes Timing und ein Interesse an minimalen Strukturen durch deine Sets.
— Das habe ich auch zu den Glanzzeiten des Kölner Minimal so gehalten. Da kann ich auch für Tobias [Thomas, Mayers Weggefährte seit Teenagertagen und Co-Resident im Kölner Studio 672], sprechen. Unsere DJ-Schule war immer durchlässig und offen. Wir fanden es langweilig, wenn man im Club zwei Stunden lang denselben Sound predigt. So haben wir unsere Rolle nicht verstanden, dazu sehen wir uns zu sehr als Entertainer.
Wurde dir das damals übel genommen, dass du nicht durch und durch den Sound deiner Stadt repräsentierst?
— Im Gegenteil. Die Unberechenbarkeit war das, was einen Abend so spannend gemacht hat. Wir haben am Ende gerne auch mal aktuellen R&B gespielt oder einen neuen Pop-Hit, der uns gerade in den Kram gepasst hat. Das hat dazu geführt, dass das Publikum sehr durchmischt war. Man hatte nicht nur die Fachidioten auf der Tanzfläche. Es ging darum, eine super Nacht zu erleben mit allen möglichen Mitteln und nicht, irgendetwas zu promoten oder verkaufen. Wenn etwas zur Form gerinnt, habe ich immer das Interesse verloren, das war beim Shuffle-Techno so, das war bei Neotrance so. Das «Selectors»-Phänomen von Dekmantel berührt auch etwas, das für mich eine grosse Rolle spielt in meinem DJing. Da wird wieder etwas in eine Form gegossen und auf einmal gibt es einen Unterschied zwischen Selectors und DJs. Da kann ich nicht mitgehen. Das finde ich dann einfach nur schade, wenn künstliche Grenzen gezogen werden und die Dinge unnötig kategorisiert und genrefiziert. Alles, was wirklich erfolgreich ist in der Szene, ist monothematisch geprägt. Das ist ein Sound, der dann über eine ganze Nacht durchgezogen wird. Das finde ich gähnend langweilig. Damit habe ich nichts zu tun, das ist nicht Teil meiner DJ-Kultur.
Du bist kein Kölner, sondern in Offenburg in Baden-Württemberg aufgewachsen. Wie hast du in deiner Kindheit die Musik entdeckt? Was ist das erste Musikstück, das du bewusst gehört hast?
— Das kann ich genau benennen. Das war Marie Myriams «L'oiseau et l'enfant» beim Grand Prix de la Eurovision de la Chanson. Das klingt wie Joan Baez´ «Here is to you», das hast so einen ähnlichen Vibe. Da kann ich mich erinnern, dass wir mit befreundeten Familien im Urlaub waren und ich Schlafsack lag, als das im Radio lief. Da muss ich so vier oder fünf gewesen sein. Der Refrain geht l'amour c'est moi, meine Schwester und ich sangen immer «Lamusetwa». Deshalb gibt es einen Track auf meinem «Mantasy»-Album, der so heisst.
In was für ein Musikverständnis bist du als Kind hineingewachsen?
— Ich komme aus dem Schwarzwald, im Küchenradio meiner Mutter liefen Schlager, auf SWR1. In den Minuten vor den Nachrichten lief dort aber oft instrumentaler Disco, so was wie Space´ «Magic Fly» oder Harry Thumans «Under Water». Solche Stücke kann man leicht ausblenden ohne dass man mit dem Fade-Out in den Text reinfräst. Das sind Songs, die mich bis heute begleiten, die ich immer noch gerne spiele.
Zu was für einer Clique hast du in deiner Schulzeit gehört?
— Ich war ein Discokid, ich habe Rockmusik nur peripher wahrgenommen. Es gab einen Nachbarsjungen, der war DJ und Laser-Operator in einem Discotempel im Dreiländereck, der der hat mich mit Mixtapes versorgt. Dass man Musik mixen kann, hat mich total fasziniert, ebenso, dass es Extended Versions von Stücken gibt, die ich schon aus dem Radio kannte. Ich habe mir eine kleine, rollende Disco zusammengebaut und Geburtagspartys und Schulpartys organisiert. Das war ein straighter Weg von Anfang an. Damals waren DJs noch verkrachte Existenzen oder shady guys, der künstlerische Ausdruck kam beim Auflegen erst in den Achtzigern zum Tragen. Dass der DJ unbekannte Musik spielt und die Leute damit trotzdem die ganze Nacht lang begeistert, das ist ein relativ neues Phänomen. Ich habe damals im Musikexpress einen Artikel über die Szene in Rimini gelesen, aus der Phase nach Italo-Disco und vor House. Da wurde beschrieben, wie die DJs tagsüber im Studio sitzen und abends in der Disco ihre Stücke testen. Das hat in mir Phantasien ausgelöst, die bis heute andauern. Ich wäre so gerne in der Glanzzeit in den Achtzigern in Italien gewesen.
Wo hast du selbst zum ersten Mal aufgelegt?
— Mit 18 hatte ich meinen ersten Discothekenjob in einer klassischen Samstag-Abend-Disco mit einer Kapazität von 500 Leuten. Man erhoffte sich, dass mit mir da ein frischer Wind reinkommt, und ich habe alles gespielt von Hip-Hop über Techno bis zum Manchester-Sound, der damals gerade heiss war. Ein halbes Jahr später wurde ich gekündigt, weil das Programm zu gewagt war für die Gegend.
Wie bist du dann nach Köln gekommen?
— Ich muss natürlich raus da. Offenburg ist eine nette Stadt, aber für jemanden wie mich ist die Grenze da schnell erreicht. Ich kannte Berlin schon recht gut, weil ich da öfter zu Besuch war. Ich konnte mir aber nie vorstellen, dort zu leben, wegen der Kohleheizungen, es gab kein funktionierendes Telefon. Im Prenzlberg in den besetzten Häusern war es immer kalt. Wenn man auflegte, warteten drei andere DJs mit ihren Plattentaschen über dem Arm darauf, weitermachen zu können, wenn du aufs Klo musstest. Dann hat sich Tobias, mit dem ich damals schon befreundet war, eben nach Köln aufgemacht. Ich habe ihn besucht, das war das Wochenende der [Popmusikmesse] Popkomm. Da war viel los. Dieser erste Eindruck stimmte natürlich nicht ganz. Aber ich dachte nur: wow, hier ist ja was los!
Wie hast du Wolfgang Voigt und die anderen gelernt?
— Das ist die alte Kompakt-Geschichte. Ich war tatsächlich der erste Kunde in dem Laden. Ich hatte gehört, dass in Köln ein Delirium[-Plattenladen] aufmacht. Ich kannte das Delirium Frankfurt. Ich war voller Hoffnung, dass ich einen Plattenladen in Köln finde, der das hat, was ich will, aber ich wurde gnadenlos enttäuscht. Da standen drei Kisten mit Hardcore Acid, und nichts von dem, was ich gerne gewollt hätte. Dann habe ich mich eben beschwert, und gesagt: Jungs, das könnt ihr nicht machen. Ihr braucht doch das und das und das und das. Die guckten mich nur mit grossen Augen an und sagten: wir sind alle Produzenten und keine DJs. Wir interessieren uns gar nicht so richtig für die Musik anderer Leute. Dann wurde mir die Liste von [dem Vinyl-Vertrieb] Discomania hingeschoben, und ich durfte selbst bestellen. Nach zwei Wochen war ich dann der Einkäufer. Wenig später habe ich das kleine, bescheidene Erbe meiner Oma, 1000 D-Mark, investiert und wurde Teilhaber. Jürgen Paape, Reinhardt und Wolfgang Voigt und Jörg Bürger gehörten da dazu. Bleed und Triple R sprangen da auch rum. Das war eine tolle, aufregende Szene, in der für meine Begriffe die falsche Musik lief. Ich war ja immer noch House DJ, während meine Freunde auf 150bpm Knüppel Acid oder auf Breakbeats standen. Vom Gefühl her und von den Sympathien war das aber definitiv der richtige Ort. Deswegen habe ich da auch angedockt.
Wie ist der reduzierte, zurückgenommene Sound entstanden, für den Kompakt zur Jahrtausendwende stand?
— Man hat sich so ineinander gepitcht. Wolfgang hat sich immer tierisch aufgeregt, wenn ich seine Platten auf -10 gespielt hab. Er fand das irgendwie respektlos. Ich habe ihm gesagt: ich kann deine Platten nicht spielen, die sind einfach zu schnell. Das ist sinnlos, die sind so schnell wie so viel Musik, die wir eigentlich ablehnen. So kam es dann, dass sie sich irgendwann etwas beruhigten. Vielleicht war das auch damals schon Altersmilde.
Warum standen die gerade auf Hardcore-Acid?
— Die Jungs waren alle von Acid-House wach geküsst worden, und der hat sich dahin entwickelt. Das subversive Potenzial von Speedfreak war auch grösser als von Sven Väth damals. Da fühlten die sich angezogen, da fühlten sie sich zu Hause.
Wie konntest du dich als DJ in diesem Zusammenhang entfalten?
— Köln war zumindest in den neunziger Jahren ein schwieriges Pflaster was Clubs anbelangt. Die formative Phase vom Delirium beziehungsweise von Kompakt fand in der Kneipe statt, im Liquid Sky vom Dr. Walker. Da gab es keine Tanzfläche, das war ein Sofa Club. Aber da hat man sich mit den Leuten von A-Musik getroffen, Holger Czukay [von Can] tauchte da plötzlich auf, das war sehr bunt und durchmischt. So war auch die Musik, sehr frei. Das hat Köln damals schon ziemlich geprägt, dieses anything goes. Dass man eben nicht einen grossen Club am Laufen halten muss, Funktion kam nach Originalität. Das war sicher sehr einflussreich für uns alle.
Wie kam es dann zum Studio 672, dem massgeblichen Kölner Club?
— Das war 1998. Das war dann glücklicherweise das Ende dieser Durststrecke, da gab es dann endlich wieder einen richtigen Club. Ralph Christoph, auch ein alter Freund aus Offenburger Zeiten, hatte den damals aufgerissen. Das war bis dahin ein Jazzclub. Der wurde dann auch nach unseren Vorstellungen umgebaut. Das Rezept war ein 300-Mann-Club, der nur aus einem einzigen Raum besteht. Man kommt rein, und man ist direkt mittendrin. Man kann sich der Sache eigentlich gar nicht entziehen. Das war eine der wichtigsten Zutaten. Es gab keinen Ausweg, es gab keine Ecke, in der man sich verstecken konnte. Wenn man in den Club reinging, dann musste man mitfeiern.
Wie hast du angefangen, selbst Musik zu produzieren?
— Ich habe früher immer gesagt: ich produziere in die Lücken meiner Plattentasche rein. Daran hat sich relativ wenig geändert. Wenn der Techno mir gerade zu gleichförmig wird, verspüre ich den Drang, ein härteres Stück zu machen, dass diesen Sound irgendwie aufbricht. Oder andersrum, ich nehme das Tempo raus, wenn alle am Brettern sind. Das ist auch stimmungsabhängig. Da ich selten ins Studio gehe, geht es erst mal darum, sich wohl zu fühlen und etwas zu schaffen, das mir gut tut.
Bei deinen Produktionen hat man das Gefühl, dass jedes Stück aus einem neuen Impuls entsteht. Es gibt kein Schema, das du wieder aufnimmst.
— Das ist meine Arbeitsweise. Ich erarbeite mir keine Soundbänke wie die hauptberuflichen Produzenten, die jeden Tag im Studio sitzen. Ich fange jedes Mal von null an, ich habe nichts, auf das ich zurückgreife. Das ist erst mal ein blankes Blatt Papier. Das ist sauanstrengend.
Bei deinem ersten Album hast du dich auf Acid konzentriert, «Mantasy» klingt poppig, beim dritten hast du bei jedem Stück mit anderen Künstlern kollaboriert. Wie kamst du auf dieses Konzept?
— Das entstand aus der Einsamkeit heraus. Ich hatte davor das Projekt mit Superpitcher, Supermayer. Wir waren jahrelang ein Studioteam. Ich musste mich erst wieder daran gewöhnen, alleine zu arbeiten, 2012 in der «Mantasy»-Phase. Ich habe da wirklich gelitten wie ein Hund. Deshalb wollte ich mich für das nächste Album wieder öffnen und Leute einladen, die ich schätze. Das war eine wunderschöne Erfahrung. Jetzt geht es wieder in das andere Extrem, jetzt grabe ich mich wieder ein.
War schwierig, den Sound aus Köln dann auch überregional und international zu spielen?
— Ich habe das überhaupt nicht als schwer empfunden. Ich bin mit einem Köfferchen mit Musik in den Club hereinmarschiert. Ich wusste schon, dass ich etwas völlig anderes machen werde als das, was hier normalerweise läuft. Ich habe dann auch gerne und oft Stücke mit deutschen Vocals gespielt, wenn ich etwa in Japan war. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute sich freuen, wenn man was anderes macht und seinen eigenen Sound mitbringt. Warum soll ich mich nach Detroit einladen lassen und dann Detroit Techno spielen? Das ist ja Quatsch. Ich wurde natürlich auch beschimpft, das ist klar, das bleibt nicht aus.
Was war damals der Feind, die Musik, von der du dich am stärksten abgegrenzt hast?
— Der Feind war das Dogmatische, sich nur in einem Sound aufzuhalten und nicht nach links und rechts zu gucken. Damals war auch die Trennung von House und Techno noch ein ganz grosses Ding. Ich fühlte mich da immer dazwischen, ich habe beides gespielt. Dann entstand in meinem Umfeld immer mehr Musik, die genau dazwischen war und die auch noch meinen Popvorlieben gerecht wurde. 2003, als ich den Fabric-Mix gemacht habe, war das vielleicht der Höhepunkt des kreativen Schubs in unserem Umfeld. Da konnte ich den ganzen Mix mit Platten bestreiten, die aus meiner Nachbarschaft kamen. Das war für die Engländer ein totales UFO, die kannten das damals noch nicht. Das würde sich heute nicht wiederholen lassen.
Damals lief in England noch kaum Musik aus Kontinentaleuropa. Der deutsche Minimalismus widersprach den opulenten, verschnörkelten britischen Sound von damals.
— Da gab es Progressive House, das war alles in Formen gegossen, da brauchte es einen Schub von aussen.
Was war für dich als DJ die komplizierteste Zeit, in der es dich am meisten Kraft kostete, deinen Sound zu vermitteln?
— Es ist tatsächlich gerade jetzt am schwierigsten, wo der Sound so monothematisch geprägt ist. Oder es herrscht das andere Extrem, das Anything-Goes der Selectors, wo ich dann manchmal denke, ich bin auf einer Schulparty von vor 25 oder 30 Jahren. Wo man hemmungslos Disco-Hits spielen kann und dafür noch Schulterklopfen kriegt. Für einen DJ wie mich ist es gerade schwierig, Gehör zu finden, weil man mich schlecht einordnen kann. Der Trend geht wie eingangs gesagt zur Berechenbarkeit. Dabei ist mein Geschmack noch breiter geworden, auch durch die Radiosendung, die ich neuerdings mache. Ich liebe es, neue Musik zu entdecken. Und ich langweile mich schnell. Aber ich werde jetzt nicht auch noch mein Faible für Weltmusik im Club ausbreiten. Ich habe eh schon zu viele Stile im Gepäck, manchmal denke ich, ich überfordere die Leute. Dabei gehen die Leute immer noch glücklich nach Hause, und ich werde auch immer noch gebucht. Irgendwas scheint also noch zu funktionieren. Man wird halt oft mit grossen Augen angeguckt. Das ist in den letzten Jahren häufiger geworden.
Gerade hast du wieder mit Tobias Thomas kollaboriert, bei «So Mad». Wie kam es dazu?
— Die Kollaborationen mit Tobias haben Tradition. Das machen wir schon seit der «Total Eins», dass wir mindestens einmal im Jahr ins Studio gehen, um einen Track für die Total[-Compilation] zu basteln. Wir haben noch nie eine Maxi zusammen gemacht. Dass es in diesem Jahr Breakbeats wurden, war nicht geplant. Ich mag besonders, dass das Stück nur zu Hälfte diesen Breakbeat hat. In der Mitte fällt der raus und das Stück wird zu etwas völlig anderem. Das ist etwas, das Tobias und ich schon immer an anderer Leute Platten geschätzt haben, dass diese Brüche entstehen, dass etwas ganz unvorhergesehenes passiert. Das kann ich wirklich zurückverfolgen bis zu einer ewigen Lieblingsplatte von Tobias und mir von Johnny Dangerous aus dem New York der Sound-Factory-Phase. Johnny Dangerous hat wilde, ungestüme Platten gemacht. Die fangen wie eine normale Harthouse-Platte an, und dann bricht irgendwann das totale Chaos los. An die Platte haben wir da auch im Studio gedacht. Das sollte sich viel öfter jemand trauen, innerhalb eines Stücks einfach mal was Verrücktes zu machen.
Gespräch: Alexis Waltz